„In Schulen lernt man auch Mut“ – Ein Interview mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer

Natürlich achtet Luisa Neubauer auf den CO2-Fußabdruck, wenn sie auf Reisen geht. Warum das nichts mit Verbotskultur zu tun, sondern etwas Befreiendes hat, erzählt die Klimaaktivistin im Gespräch – und wie Mücken und Gegenwind an der Ostsee ihr Weltbild prägten.
Interview: David Schumacher
Kämpferin für Klimaschutz
Ihr Engagement für „Fridays for Future“ machte Luisa Neubauer 2019 bekannt. Heute ist die 29-Jährige Geografin eine bekannte Klimaaktivistin. Die Hamburgerin schreibt Bücher und erinnert in Talkshows, auf Lesereisen und Konferenzen daran, dass der Klimawandel wirksam und sozial gerecht bekämpft werden muss.

David: Was ist deine erste Erinnerung an eine Klassenfahrt?
Luisa: Läusealarm für alle. (lacht) Das war in der Grundschule. Wir hatten aber eine super Zeit! Es ging nach Niebüll in Nordfriesland.
David: Heimweh gehabt?
Luisa: Meine Mutter hat mir bei solchen Reisen immer eine Postkarte vorausgeschickt. Wenn ich ankam, lag da diese Karte für mich in der Jugendherberge. Das ist ein sicheres Rezept gegen Heimweh.
David: Wann hat sie damit angefangen?
Luisa: Schon vor dieser Klassenfahrt, es ging auf Kirchenchorreise in die Lüneburger Heide. Ich kann mich gut erinnern, wie wir ankommen und in der Herberge empfängt uns ein besonderer Linoleumgeruch. Ein ständiger Begleiter meiner Kindheit sozusagen.
David: Oben oder unten schlafen?
Luisa: Wie viele Leute habe ich eine Oben-Präferenz gehabt. Aber ich habe oft anderen den Vorzug gelassen. Das änderte sich, als ich anfing, mit meiner Familie Hüttenwanderungen in den Alpen zu machen.
David: Inwiefern?
Luisa: Na ja, die stinkigen Wandersocken … Da wurde ich etwas spezifischer, wo ich gern schlafen möchte.
David: Und zwar?
Luisa: Natürlich nah am Fenster.
David: Gab es eine Reise mit deiner Familie, über die ihr Jahre später noch redet?
Luisa: Meine Eltern haben mit mir und meinem Bruder mal eine Reise ins Blaue gemacht. Das Konzept kannten wir als Kinder gar nicht. Wir fuhren wie immer mit dem Zug. Es ging nach Süden, meine Eltern sagten: „Mal sehen, wohin es uns verschlägt.“ Und das war die Jugendherberge in München. Die hatten so Hängematten draußen auf dem Spielplatz. Darin schaukelten wir, und ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Als stünde uns die ganze Welt offen.
David: Wie ging die Reise weiter?
Luisa: Wir fuhren mit einer Droschke durch München. Damals musste meine Puppe Maria mit auf jede Reise. Aber in dem Moment schaute ich sie an, und mir wurde klar: Das ist ja nur ein Stück Plastik! Das war Marias letzte Reise mit mir. Sie führte uns noch bis Italien.
David: Wie haben Reisen dein Verständnis von der Welt geprägt?
Luisa: Es ging los mit einer Fahrradtour entlang der Ostseeküste. Von Lübeck nach Usedom, mit meiner Mutter, einer Freundin von ihr und deren Tochter. Wir übernachteten in Jugendherbergen, wir sind seit jeher Mitglied gewesen. Ich war vielleicht in der dritten Klasse, hatte gerade ein neues Rad mit Gangschaltung bekommen. Jeden Tag strampelten wir gegen die Mücken und den Gegenwind an. Aber es war uns klar: Wir müssen abends irgendwo ankommen. Das fand ich schon als kleines Kind toll.
David: Gab es eine weitere Schlüsselreise?
Luisa: Unsere Kirchengemeinde unterstützte ein langjähriges Projekt in Tansania. Wir probierten, unsere Partnergemeinde dabei zu unterstützen, eine Wasserleitung zu bauen. Ich durfte mit einigen anderen Jugendleitern nach Tansania reisen, um die Gemeinde kennenzulernen und die Wasserleitung einzuweihen. Ich sah die fertige Leitung, aber es gab nicht genug Wasser. Wir standen im Hochland, wo Hirse oder Mais angebaut werden sollten. Und uns wurde klar: Da wächst nichts, weil sich das Klima verändert hatte.
David: Über die Klimakrise ist vieles lange bekannt und wird auch in Schulen gelehrt. Aber Wissen allein scheint nicht viel auszurichten. In deinem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind“ plädierst du dafür, den Gefühlen zur Krise genauso viel Beachtung zu schenken wie den Zahlen. Wie kann Reisen dazu beitragen?
Luisa: Man sollte sich zunächst fragen: Was heißt Reisen für einen selbst? Wenn ich das Grab meines Vaters besuche, der vor neun Jahren starb, mache ich eine Reise. Und ich stehe dabei nur auf einem Fleck von ein paar Quadratmetern auf einem Friedhof. Wenn ich Aufzeichnungen einer Dichterin wie Mascha Kaléko lese, die über den Weltkriegsbeginn schreibt, ist das auch eine Reise. Wie alles, was uns in andere Lebenswelten und Erfahrungsräume katapultiert. Nur weil etwas eine Reise im geografischen Sinn ist, muss es nicht eine emotionale Reise sein, die dich weiterbringt.
David: Wenn du eine Reise planst: Wie sehr spielt der CO2-Fußabdruck eine Rolle?
Luisa: Noch zu Beginn meines Geografiestudiums war ich überzeugt: Es geht auch um meine Ausbildung, dazu gehört es zum Beispiel, die Welt zu erkunden und Sprachen zu lernen. Das ist auch die Kultur, in die wir jungen Leute hineingeboren sind. Heute denke ich: Das Reisen braucht es vor allem, damit Menschen sich treffen und kennenlernen. Aber die Emissionen, die gerade mit dem Fliegen verbunden sind, bringen immer eine Verantwortung mit sich. Es ist nicht zu viel verlangt, sich zu fragen: Ist es das wert? Oder kann ich das anders machen?
David: Zum Beispiel per Bahn?
Luisa: Ich würde fast sagen, dass ich in Europa jede Zugstrecke in Kauf nehme, um nicht fliegen zu müssen. Von Hamburg zur Klimakonferenz in Madrid zuckele ich aber gemütlich mit dem Zug. Ich finde, es hat auch etwas Befreiendes, wenn man sich fragt: Was ist meine Absicht mit dieser Reise? Das hat nichts mit Verbotskultur oder Ökomoralismus zu tun, sondern damit, sich selbst ernst zu nehmen.
David: Lehrkräfte vermitteln viel Wissen über den Klimawandel, das ist für sie sicheres Terrain. Aber gehören Fragen von Gefühl und Moral ebenso zum Bildungsauftrag?
Luisa: Im besten Fall verändert sich das schulische Lernen. Früher dachte man: Ein weiterer Fakt, und dann haben wir’s. Wenn wir den Treibhauseffekt durchgenommen haben, dann kriegen wir es in den Griff. Stattdessen haben wir heute eine Jugend, die in großen Teilen Klimaangst hat. Die hat gelernt, wie die Welt funktioniert. Aber nicht, wie sie damit emotional umgeht. Oder wie man sich zusammentut, um Wandel zu bewirken. Wir wissen, dass junge Menschen Kraft und Kreativität brauchen werden. Und ein Verständnis von Wirksamkeit und Einsatz. Gerade auf Klassenreisen hat man Zeit und Raum, das zu lernen.
David: Im außerschulischen Lernen steckt also Potenzial. Aber ist es nicht oft eine Übung für das gute Gewissen, wenn man auf Klassenfahrt mal einen Vormittag lang Müll am Strand einsammelt?
Luisa: Klar, das täte vermutlich allen Generationen gut, nicht nur jungen Leuten. Aber ich kann mir außerdem vorstellen, wie mühevoll das ist, Klassenreisen zu organisieren und noch mitdenken zu müssen, dass es einen zusätzlichen Mehrwert gibt. Ich habe drei Winter lang als Skilehrerin in Österreich gearbeitet. Immer hat jemand die Handschuhe vergessen, an der Gondel wird gedrängelt, irgendwer muss aufs Klo, und ich versuche, zwanzig Kindern etwas zu vermitteln.
David: Nicht jedes Kind hat Lust auf das Programm.
Luisa: Ich erinnere mich an eine Fahrt mit der achten Klasse. Wir galten als unerzogen und unerträglich. Es gab eine Woche Erlebnispädagogik. Kanu fahren, Zelte aufbauen, Vertrauensübungen mit zusammengeknoteten Schürsenkeln machen. Wir fanden es nervig und peinlich. Aber wir haben uns lange daran zurückerinnert und festgestellt: Da ist doch etwas hängen geblieben.
David: Eine aufrichtende Botschaft.
Luisa: Ja. Ich möchte den Lehrer*innen sagen: Nicht verzagen! Die Zeiten sind hart, vieles ist überwältigend. Aber ich kenne niemanden, der nicht mit einem warmen Gefühl auf diese eine Lehrerin oder diesen einen Lehrer zurückblickt und denkt: Der oder die hat etwas in meinem Leben verändert. Wir brauchen mutige Menschen. Und die Schule ist auch ein Ort, wo man Mut lernt.
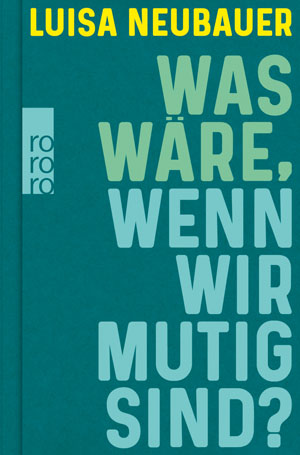






Du musst angemeldet sein, um Kommentare sehen und verfassen zu können